
© Alle Rechte vorbehalten | Letzte Aktualisierung 25. Oktober 2022 | Kontakt | Datenschutzerklärung
Der Kegelsteller
Wenn man sich für Kegelbahntechnik interessiert,
sind die Kegelsteller die wohl interessantesten
Konstruktionen einer Bahneinheit. Auf dem
nebenstehenden Bild ist ein FUNK-Kegelsteller aus
dem Jahre 1984 zu sehen, der bereits zum alten
Eisen gehört.
Auffällig bei diesen alten Modellen ist, dass die
Stellautomatik offen ist und nicht, wie bei neueren
Modellen, in einem Metallkasten abgesichert ist.
Allerdings lassen sich die Vorgänge umso besser beobachten. Ein ausführliches Video über eine dieser Bahnen finden
Sie hier.
Dieses zweite Bild wurde kurz nach dem Einbau eines neuen Vierpasses aufgenommen. Der alte ist am Vorderholz
geplatzt, sodass eine neue Platte her musste. Es ist der Vierpass-Unterbau zu sehen, der sich unter einer
Kunststoffplatte und einer ca. 4cm dicken Holzplatte befindet. Die alte Vierpassplatte hatte eine Dicke von 5mm, die
neue 10mm. Der DKB schreibt jedoch vor, dass die Vierpassplatte (eigentlich "Kegeltischplatte") einige Millimeter tiefer gelegen sein muss als die
Kugellauffläche. Diese Auflage erfüllte die neue Platte nicht mehr, weshalb der gesamte Unterbau um 5mm abgesenkt werden musste. Jetzt läuft die Kugel
ungestört über die Kante und springt nicht.
Auf diesen beiden Bildern befinden sich die Zentrierglocken. Beim
Stellvorgang werden die Kegel in diese Becher gezogen, um das Pendeln zu
beenden und sie am Vierpass auszurichten, d.h. zu "zentrieren". Auf älteren
Bahnen sind auch einfache Zentrierplatten anzutreffen, welche nicht über
Zentrierglocken, sondern Zentrierlöcher verfügen. Ein Beispiel für diese
Variante finden Sie in diesem Video.
Der Nachteil des Zentrierloches (vor allem bei SPIETH-Bahnen) liegt darin, dass diese Ausführung nicht kompatibel mit der
breiten Kegelform ist - sie bleibt stecken (wobei es eine Möglichkeit gibt, die Zentrierung für dicke Kegel zu modifizieren).
Eine gute Zentrierung zeichnet sich dadurch aus, dass sich ein Kegel nicht bewegt, selbst wenn er nicht ganz bis zum
Anschlag gezogen wird. Diese Eigenschaft beizubehalten war die Schwierigkeit am Design des dicken Kegels. Bei den
Zentrierungen mancher Hersteller wird der dicke Kegel wesentlich ungenauer zentriert als der dünne.
Diese beiden Bilder zeigen die Standplatten, an denen die Kegel ausgerichtet
werden. Sie haben im Regelfall einen Durchmesser von 65mm. Es gibt eine flache
Ausführung und eine Ausführung mit Loch. Die Standplatten erfüllen zwei
Funktionen:
Erstens geben sie Aufschluss über die Genauigkeit der Zentrierung. Überschreitet
der Standpunkt des Kegels eine bestimmte Toleranz, wird dies negativ ins Protokoll der Bahnabnahme aufgenommen. Zweitens gibt es einige
Kegelfabrikate, vor allem alle Kegel der dünnen Form, die mit einer Kugel in der Standfläche ausgestattet sind.
Dieses Foto zeigt die Standfläche eines Kegels der dünnen Ausführung. Ein solcher Kegel steht nur auf der
Vierpassstandplatte und fällt sofort um, wenn er verschoben wird. Damit das Fallverhalten nur wenig durch
die Kugel beeinflusst wird, ist die Kugel gefedert und wird in den Boden des Kegels gedrückt, wenn er
verschoben wird. Der Federdruck ist gerade so groß, dass der Kegel auf ebenem Boden umfällt, aber so
gering, dass die Kugel beim Treffen im Kegel verschwindet.
Dieser Aufwand hat den Zweck, die Kegel bei jedem Stellvorgang exakt gleich zu positionieren. Wenn ein
Kegel ungenau zentriert wird, fällt er um und der Zentriervorgang beginnt von vorne (was bei guten Bahnen nie passiert). Die Standplatte auf dem Boden
hat einen sehr großen Radius am Loch, sodass es wie ein Trichter wirkt und ein beim Absenken abweichender Kegel zurück an seinen Platz rutscht. Auf diese
Weise stehen die Kegel bei jedem Wurf nahezu indentisch.
Es gibt Kegel der dicken Form, die über keine Zentrierkugel verfügen. Bei diesen kann es vorkommen, dass das gestellte Kegelbild falsch steht, zumal
manche Zentrierungen ohnehin fehleranfällig sind, wenn der dicke Kegel eingesetzt wird. Solche Kegel können beim Stellvorgang auch in das Zentrierloch
rutschen und umkippen. In diesem Fall empfiehlt sich die Verwendung flacher Standplatten. Bei Kegeln ohne Zentrierkugel liegt der Schwerpunkt weiter
oben, was sie selbstverständlich leichter kippen lässt. Um dies auszugleichen, beträgt der Bodenradius eines Kegels ohne Kugel 6mm, eines Kegels mit
Zentrierkugel jedoch 8mm.
Dieses Foto zeigt den Kegelsteller von der Seite während eines Stellvorgangs.
Eine Stange läuft an Ketten geführt vor und zurück. An dieser Stange befinden
sich Umlenkrollen, durch welche sich die Seile bewegen. Läuft die Stange nun
mit der Geschwindigkeit x nach hinten, bewegen sich die Kegel mit
Geschwindigkeit 2x nach oben, da das Seil an der Stelle der Umlenkung nach
hinten gezogen wird. So sind alle Kegel an einer mechanischen Einheit
befestigt, sodass sich die Kegel prinzipiell nicht unabhängig voneinander
bewegen können.
Der Aufbau dieser Einheit variiert von Hersteller zu Hersteller. Das Bild zeigt
die Linearausführung, die z.B. FUNK verbaut. Hier bewegt sich die Zugstange
nach hinten, hält kurz inne und fährt wieder zurück. Daneben gibt es außerdem die Rundläuferausführung, die z.B. bei SPELLMANN zu sehen ist. Hier stoppt
die Zugsatange hinten nicht, sondern bewegt sich um die hintere Achse herum und fährt unten wieder zurück. Daraus resultiert eine kürzere Verweildauer
der Kegel in der Zentrierung und damit oftmals eine höhere Aufstellgeschwindigkeit.
Die nächsten Bilder zeige die Federarme. Daran ist das andere Ende des Kegelseils
befestigt. Die Federarme erfüllen drei Aufgaben:
1. Durch die Federung wird der Stellvorgang harmonischer und das Material wird
geschont (v.a. die Seile, aber auch die
Kegel und die Zentrierringe).
2. Bei Seilverwirrung schlagen die
Federarme voll aus und berühren eine
weitere Stange (im Bild rot). Dadurch
wird die Seilentwirrungsautomatik
gestartet. Diese hängt sehr stark vom
Hersteller ab; bei der FUNK-Variante
harren die Kegel zunächst oben aus.
3. Jeder Federarm enthält eine Vorratsrolle, auf der das Seil aufgewickelt wird. Durch Drehen an der Rolle kann die
Höhe der Kegel eingestellt werden. Außerdem kann, wenn ein Kegel einmal abreißt, die Rolle einfach ein Stück
weitergedreht werden. Das Seil auszutauschen ist eine aufwändige Arbeit und muss so seltener durchgeführt
werden.











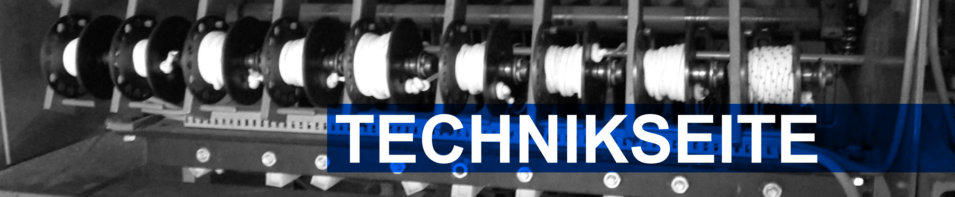
…einen Wurf weiter.

















